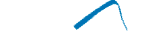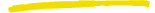Redebeitrag von Thilo Weichert
Freiheit statt Angst
Abschlusskundgebung der Demonstration in Kiel am 13.06.2015
Die Digitalisierung unserer Gesellschaft könnte eine wundervolle Sache sein: unbeschränktes weltweites kommunizieren und informieren. Computer und Roboter nehmen uns langweilige Routine und schwere Arbeit ab. Wir könnten uns in der Freizeit und im Beruf mit informationstechnischer Unterstützung entfalten. Wir könnten im Betrieb, im sozialen und im politischen Leben online mitsprechen und mitbestimmen. Alles das ist mit Digitalisierung heute grundsätzlich möglich.
Es gibt aber eine andere Seite, und die ist furchterregend. Da werden alle unsere Lebensäußerungen – vom Smartphone über Videokameras bis hin zu unseren elektronischen Zahlungen digital erfasst und langfristig gespeichert. Mit diesen Daten werden Persönlichkeitsprofile erstellt, auf deren Grundlage wir als Verbraucherinnen und Verbraucher nicht selten belästigt, manipuliert und abgezockt werden. Die digitalen Profile nutzen Geheimdienste, um uns auszuspionieren und um uns als potenzielle Terroristen, als Dissidenten oder als mögliche Quelle für Wirtschaftsspionage zu markieren und zu kontrollieren, oder einfach, um uns in unserer Meinung zu manipulieren.
Der letzte Schrei der Digitalisierung heißt Big Data, womit die vielen Daten zusammengeführt und analysiert werden, um dann Algorithmen die Aufgabe zu übertragen, Entscheidungen über unser Leben zu treffen. Heute sind dies Entscheidungen über Kreditverträge, deren Bedingungen durch Computerscoring festgelegt werden, oder Versicherungsverträge, bei denen wir digital als besonderes Gesundheitsrisiko oder als Gefahr für den Straßenverkehr eingestuft und mit unseren Prämien hochgestuft werden.
Schon heute entscheiden Computer, ob wir in einem Bewerbungsverfahren zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Herangezogen werden dann möglicherweise Daten, die wir selbst oder andere in sozialen Netzwerken über uns veröffentlicht haben.
All das spielt sich im Hintergrund ab. Welche Daten von uns wie verarbeitet und genutzt werden, das verschweigen uns NSA und BND, aber auch Google, Apple, Amazon oder Facebook. Auch deutsche Firmen, z. B. die Schufa, verweigert uns – im konkreten Fall mit dem Segen des deutschen Bundesgerichtshofes – Auskunft über die relevanten Merkmale ihrer Scoreberechnung.
Als ob es nicht schon genug Daten von uns gäbe, mit denen wir gläsern gemacht werden, fabulierte da ein Wirtschaftsweiser – unter dem Applaus der IT-Wirtschaft – von der Abschaffung des anonymen Bargeldes, damit auch noch der Brötchenkauf beim Bäcker personenbezogen überwacht werden kann.
Eine solche Gesellschaft will ich nicht – wollen wir nicht. Die Freiheit, die uns unser Grundgesetz und die Europäische Grundrechte-Charta versprechen, setzt voraus, nicht Angst davor haben zu müssen, dass wir überall erfasst und dass diese digitalen Spuren zur Diskriminierung und Manipulation verwendet werden. Unsere Demokratie, die in der Bundesrepublik erst mühsam erlernt und in der DDR erkämpft werden musste, wollen wir nicht aufgeben zugunsten von Entscheidungen von Computern, die im Auftrag von irgendwelchen Unternehmen programmiert wurden zwecks optimierter Profitmaximierung, und die uns dann erklären, dass sie doch nur „unser Bestes“ wollen. Und unsere Rechtsstaatlichkeit darf nicht Grenzen haben, wenn ein US- amerikanischer Konzern seine Europafiliale in Irland betreibt oder ein US-amerikanischer Geheimdienst eine ach so freundliche Partnerschaft mit einem deutschen Geheimdienst pflegt.
Es ist geradezu vordemokratisch und totalitär, wenn Geheimdienste und Internet-Unternehmen über uns alles wissen dürfen, wir aber praktisch nichts über diese. Genau das ist gelebte Realität, wenn selbst geheim tagenden Parlamentsgremien, wie dem NSA-Untersuchungsausschuss, aus Rücksicht auf Partnergeheimdienste ihre Kontrollrechte verweigert werden, oder wenn die Googles und Facebooks nicht nur ihre unzulässige Praktiken langjährig fortsetzen dürfen, sondern hierzu dadurch ermuntert werden, dass z. B. eine Bundeskanzlerin zu einem Eric Schmidt aus dem Silicon Valley pilgert, oder dass sie eine offizielle Facebook-Fanpage einrichtet und damit Menschen animiert, deren Daten in Facebooks Rachen zu lenken.
Der Zustand ist beängstigend. Er darf uns aber keine Angst machen. Es gibt eine positive Utopie einer freiheitlichen und demokratischen Informationsgesellschaft. Hierfür sollten wir uns einsetzen. Es gibt genügend Anlässe, weshalb wir unsere Stimme erheben müssen.
- Derzeit behandelt der Bundestag ein Geheimdienstgesetz, mit dem Konsequenzen aus den NSU-Morden gezogen werden sollen. Statt aber nun den Verfassungsschutz besser zu kontrollieren, soll dieser noch mehr Befugnisse und mehr Macht bekommen. Das darf nicht sein.
- Derzeit diskutiert der Bundestag ein IT-Sicherheitsgesetz, das dazu führt, dass u. a. beim Verfassungsschutz personell massiv aufgestockt wird. Wir fordern stattdessen eine Aufstockung bei den unabhängigen Datenschutzkontrollbehörden. Das wäre nicht nur bessere IT-Sicherheit, sondern auch ein wirksamerer Schutz unserer Verfassung.
- Derzeit will die Bundesregierung eine Vorratsspeicherung von Telekommunikationsverkehrsdaten durchziehen mit undifferenzierten, viel zu langen Speicherfristen. Das dürfen wir nicht durchgehen lassen
- Und derzeit versucht ein NSA-Untersuchungsausschuss mit sehr begrenztem Erfolg, Licht in die Bespitzelung durch NSA, GCHQ und BND zu bringen. Wir fordern voll demokratische Kontrolle, wozu auch die Offenlegung der Selektorenlisten gehört, auf deren Grundlage der BND der NSA Amtshilfe leistet.
- Die Bundesregierung hat lange Zeit die Europäische Datenschutzgrundverordnung blockiert. Wir fordern eine schnelle Verabschiedung auf der Grundlage der Vorschläge des Europaparlaments.
- Und wenn es um den organisierten Datenaustausch mit den USA geht, etwa bei TTIP oder Safe Harbor, sind die Bundesregierung und Europa bereit, gemäß der Forderung der USA unsere Grundrechtsstandards aufzugeben. Wir fordern ein klares Nein zu dieser Forderung und verlangen stattdessen, endlich Edward Snowden in Deutschland politisches Asyl zu gewähren.
Digitale Rechte sind keine Rechte, die nur eigenen Staatsangehörigen zustehen, sondern als allgemeine Menschenrechte allen. Wir fordern die deutsche Bundesregierung, die Institutionen in der EU und auch die Obama-Administration und die vielen US-Unternehmen, die uns derzeit schamlos kontrollieren, auf, dies zu akzeptieren und die täglich stattfindenden Menschenrechtsverletzungen zu beenden.